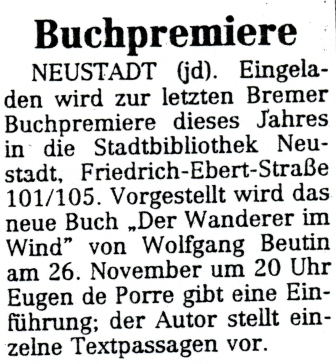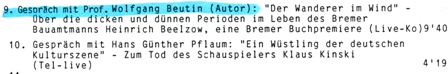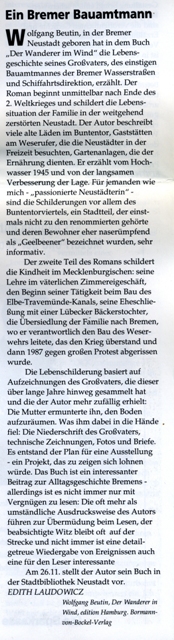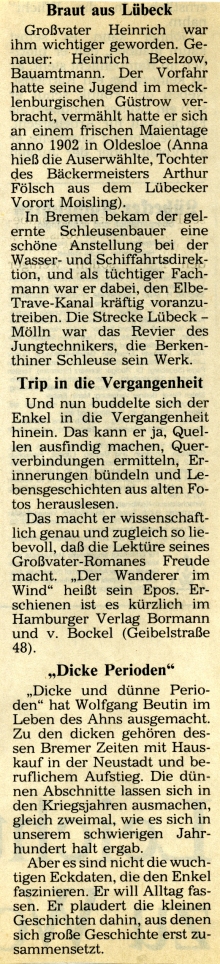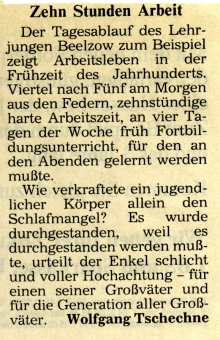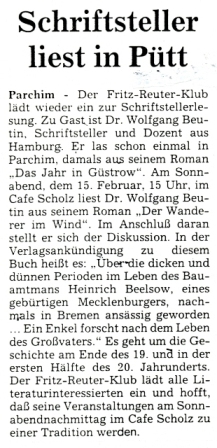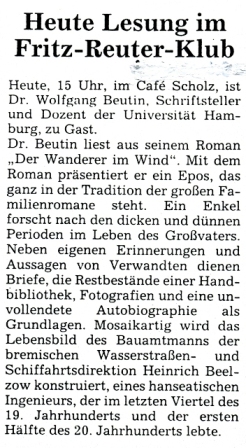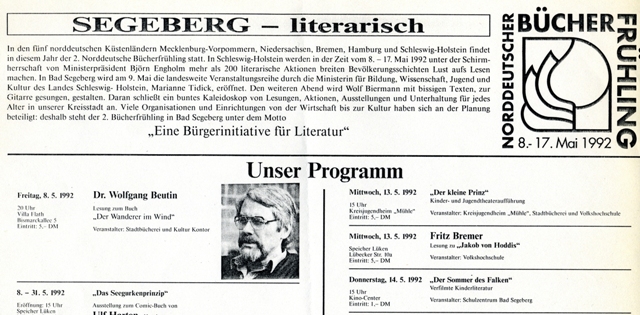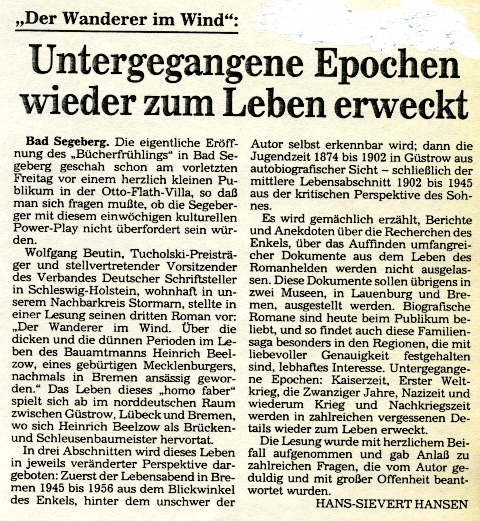|
Aus: Neue Zeit (Berlin), 29. Oktober 1991
Erinnerungen an den guten Geist
des Großvaters.
Beutins Familienroman "Der Wanderer im Wind"
Etwa in der
Mitte des Romans berichtet der Ich-Erzähler Lothar vom Besuch einer
Barlach-Ausstellung in Güstrow. Dabei fragen er und seine Frau Jütte, warum man
eigentlich immer nur das "überragende" präsentiere und nicht "Menschen des
Alltags". Das scheint die Keimzelle des vorliegenden Buches gewesen zu sein,
eine Anregung, Ursprünge zu erforschen und auf Spurensuche zu gehen nach dem
faszinierenden Ahnherrn und Bauamtmann Heinrich Beelzow und dessen Kreis.
Es
entstand ein "Familienroman" mit Ewigkeitsthemen von den Wechselfällen des
Lebens, Liebe und Tod. Hier mögen sich Reminiszenzen einstellen an berühmte
Vorläufer wie Zollas "Rougon-Macquart"-Zyklus, Thomas Manns "Buddenbrooks",
Galsworthy "Forsyte-Saga" u.a., die der promovierte Literaturwissenschaftler und
Schriftsteller Wolfgang Beutin (geb. 1934) selbstverständlich kennt und schätzt.
Er ordnet sich durchaus in diese Tradition ein. Aber obwohl er in vergleichbarer
Weise fabuliert und eine Fälle (anfangs nicht leicht überschaubarer) Personen
charakterisiert, Verwandte und Bekannte, Eltern und Voreltern, kuriose
Episodenfiguren, wählt er bald "moderne" Darbietungsformen.
So läßt er seinen
Chronisten sorgsam recherchieren und ein Dasein rekonstruieren aus Urkunden,
Briefen, Notizen, vertraulichen Auskünften und persönlichen Erinnerungen.
Wiederholt durchbricht er die Generationsgeschichte, teilt Informationen aus
verschiedenen Blickwinkeln mit und verbindet die Großvaterbiographie mit der
eigenen. Ihm gelingt eine epische Dokumentation vom ausklingenden vergangenen
bis zur Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts mit Zeitbildern, die vor allem
jüngeren Lesern das Vergnügen mittelbarer "Augenzeugenschaft"
ermöglichen.
Zunächst hören wir vom Pensionsalltag des ehemaligen
Baumeisters, Ingenieurs und jetzigen alten Herrn Heinrich, der sich nach dem
Zweiten Weltkrieg zielstrebig und erfolgreich um die Wiedergewinnung von Haus
und Besitztümern bemüht. Ein wieder aktuelles Thema, ebenso wie jenes von
damaliger Geldentwertung, Mißgunst und Denunziation. Einprägsam die Szenen von
der Wohnungsnot, Hunger, Kälte, Hamsterfahrten aufs Land und kargen
Kindheitsfreuden. Für den Erzähler erweist sich der Großvater als "guter Geist"
mit "humoristischem Wohlwollen", dem der Junge in trüber Nachkriegszeit vieles
verdankt. Vor allem Bildungsgüter wie Raabe, Reuter und Wilhelm Busch, deren
Nachwirkungen im Roman spürbar sind. Am Ende der Geschichte ist Old Henri nicht
älter als zu Beginn, weil der Chronist zunächst dessen letztes Lebensjahrzehnt
und eigene Jugenderfahrungen schildert und Früheres später nachholt.
Im
zweiten Teil wertet er dann weitgehend "Nachlaßtexte" aus, berichtet von Opas
Schul-, Wander- und Tiefbautechnikerzeit in Güstrow, Altstrelitz, Fürstenberg,
Lübeck, Bremen und anderen Orten. Dabei wird oftmals Essayistisches und
Kommentierendes gemischt mit biographischen Denkwürdigkeiten und Proben aus
"authentischen" Aufzeichnungen, die der Zitator als eulenspiegelhaft empfindet,
eine "Schwanksammlung" mit "plattdeutschem Volkshumor". Der Autor selbst
betrachtet sie nur als "Steinbruch für Erkenntnisse". Vielleicht hätte er den
schalkhaften Wesenszug des Großvaters noch stärker dominieren lassen sollen in
seinem nachdenklich stimmenden Roman vom Woher und Wohin einer deutschen
Familie.
Eberhard Hilscher
|
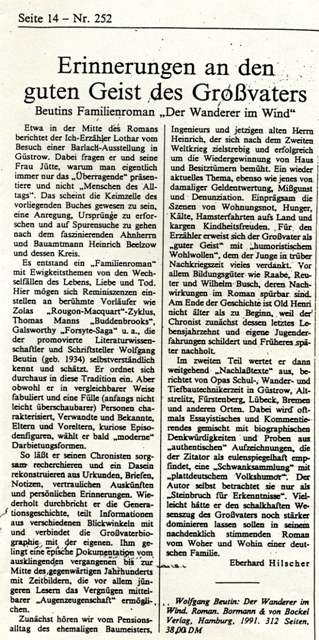
|
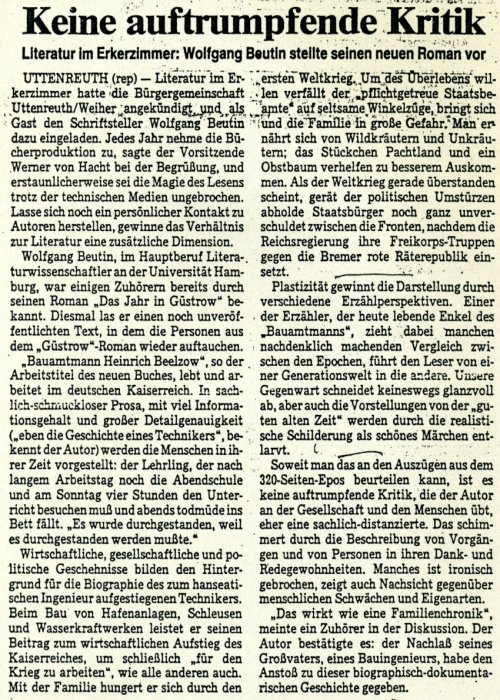
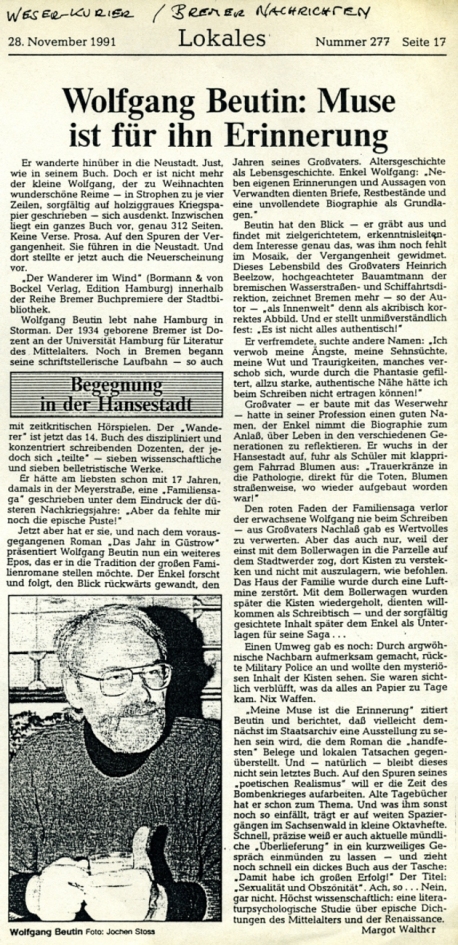

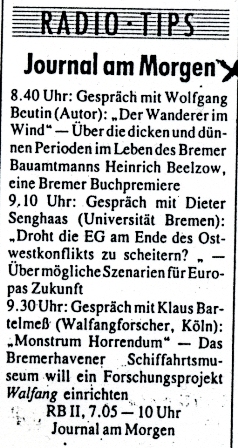 TAZ-Bremen, 26.11.91
TAZ-Bremen, 26.11.91